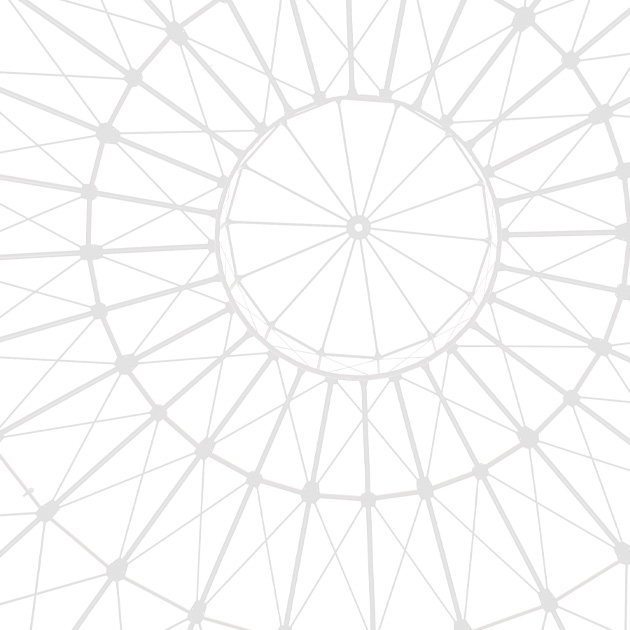Das neue Gutachten des Sachverständigenrates (SVR) stützt, nicht wirklich unerwartet, die aktuelle Denk- und Marschrichtung des Gesundheitsministers. Dieser hatte schon seit langem medienwirksam auf den Rat und Einfluss von Lobbygruppen verzichten wollen, zu Gunsten der akademischen Kollegen. Universitäre statt institutioneller Forschung also. Aber gerade, weil das Gutachten eine Silhouette der aktuellen Gesetzgebung ist, lohnt ein kurzer Einblick. Für die Eiligen: Ganz am Ende des Textes haben wir den MVZ relevanten Absatz in Gänze zitiert. Das aktuelle Gutachten des Sachverständigenrates wurde unter dem Titel „Fachkräfte im Gesundheitswesen | Nachhaltiger Einsatz einer knappen Ressource“ veröffentlicht. (~ zum Bericht | öffnet als PDF) Der Bericht geht unter der Maßgabe der Personalkapazitäten verschiedene Aspekte an. Zusammenfassend lässt sich die Problemstellung und Zielsetzung in einem Satz wiederfinden: „Ziel [ist die] Reallokation der knappen Personalressourcen im Sinne einer bedarfsgerechten und humanressourcenschonenden Versorgung“. (S. röm. 28) Das Gutachten erkennt an, dass auch außerhalb der Gesundheitsökonomie der Fachkräftemangel Lücken in systemrelevante Branchen reißt. Die Gesundheitsbranche steht somit in Konkurrenz, allerdings um eine ‚Ressource‘, die es auch anderswo benötigt, damit der Gesundheitssektor finanziert werden kann. Ein wahres Dilemma. Der SVR schlägt also Maßnahmen vor, mit weniger Personal mehr Menschen – unter Bezug auf die Babyboomer Generation – versorgen zu können.
Auf der makroskopischen Ebene folgt der SVR der aktuellen Politik, bzw. eigentlich ist die Kausalität umgekehrt. Die aktuellen Gesetzespläne zum Krankenhausgesetz (KHVVG) und Versorgungsgesetz (GVSG) folgt wohl den Vorschlägen des SVR. Gemäß des Rates wäre in struktureller Hinsicht „Ein zentraler Hebel [...] die Reduktion der stationären Belegungstage durch verbesserte Koordination und Ambulantisierung.“ Dafür sollen auch die Hybrid DRGs weiterentwickelt werden. Außerdem schlägt der SVR eine verbesserte Patientensteuerung vor. Eine Säule soll dabei das Primärarztsystem darstellen, außerdem ist angedacht: „Integrierte Leitstellen (ILS) und Integrierte Notfallzentren (INZ) einzurichten sowie Einsätze des Rettungsdienstes zukünftig als eigenständige, präklinische notfallmedizinische Leistung abzurechnen, um die Notaufnahmen und damit die personellen Ressourcen in den Krankenhäusern zu entlasten.“ Im Kontext der umstrittenen Level-1i Krankenhäuser, die der Hausärzteverband als Erosion der Sektorgrenzen zu Lasten der ambulanten Versorgung wahrnimmt, ist ein weiter Vorschlag des SVR richtungsweisend: „Der Rat empfiehlt, eine sektorenübergreifende Bedarfsplanung ambulanter Leistungen zu etablieren.“ (S. röm. 28) Bisher stehen den Landesgremien nur Empfehlungen im Rahmen von „sektorenübergreifenden Versorgungsfragen“ (~ § 90a SGB V) zu.
Der Bericht geht ferner auf die Klassiker ein. Mehr Befugnisse für Pflegekräfte/MFA, mehr Verantwortung für Patienten im Sinne der Inanspruchnahme, aber auch der Gesundheitskompetenz. Auch die Ärzte sollen in die Verantwortung genommen werden. So möchte sich der SVR ein Beispiel am europäischen Ausland nehmen: „In einigen europäischen Ländern wird die Anzahl der Weiterbildungsplätze quotiert, sodass eine freie Wahl der Facharztweiterbildung nicht ohne Weiteres möglich ist.“ Die Ausführungen dazu sind auf Seite 177 des Berichtes skizziert, allerdings gab es bereits starken Gegenwind und es ist fraglich, ob dies in Deutschland so umsetzbar ist.(~ Ärztekammer lehnt Quotierung der Weiterbildung ab | Ärzteblatt v. 30.04.2024) Auch die Pflegekräfte möchte man zukünftig steuern, oder zumindest eine Koordinierung durch ein „nationales Monitoring der Personalressourcen“ anstreben. Außerdem ein Ausbau der TI und Abwägung der Nutzung von KI. Ebenso nicht ganz neu sind die Überlegungen Richtung eines verpflichtenden sozialen Jahres.
Die 332 Seiten sind voll mit weiteren Vorschlägen und Ideen, von denen viele schon länger in der Diskussion stehen. Jedoch braucht es nun einmal oft stetige Wiederholung, damit die notwendige Dringlichkeit aufgebaut wird oder die Erkenntnis einsetzt. Das gilt für den diesjährigen Bericht besonders für MVZ. Über das gesamte Paper werden Punkte wie Arbeitnehmerattraktivität, Effektivität und Effizienz im Einsatz von Personal-Ressourcen aufgenommen. Die Erkenntnisse kumulieren in einer guten Zusammenfassung, die wir hier schlicht zitieren: „Die ambulante medizinische und pflegerische Versorgung wird oftmals durch Kleinbetriebe (z. B. Einzelpraxen) mit einer sehr geringen Mitarbeiterzahl erbracht. Der Rat empfiehlt, die Etablierung größerer organisatorischer Einheiten zu fördern, um Skaleneffekte zu realisieren und vorhandene Personalressourcen effizienter zu nutzen. Sinnvoll konzipierte größere Einheiten können attraktive Anstellungsformen bieten, indem sie u.a. eine bessere Aufgabenteilung zwischen den Berufsgruppen mit Spezialisierung der Beschäftigten einschließlich der medizinischen Fachangestellten ermöglichen.“ (S. röm. 15 | siehe auch S. 158) Chapó! Klar muss aber sein, dass damit nicht nur MVZ, sondern eben auch womöglich sektorübergreifende Versorgungseinrichtungen gemeint sind. Dennoch ist diese Klarstellung begrüßenswert. Viele der Ansätze sind langfristig gedacht, es wird sich zeigen, inwiefern zukünftige Regierungen diesen Richtungseinschlag mittragen. Dass etwas geschehen muss, darin sind sich aber wohl alle einig.